„Rolle den Redeteppich aus, über den wir uns in die Geschichte hinein wie in einen Aufführungsaal begeben und unsere Plätze einnehmen.“
Gleich dieser erste Satz aus Peter Wawerzineks neuem Buch Rom sehen und nicht sterben zieht den Leser in einen Theaterraum der Sprache. Hier wird nicht bloß erzählt, hier wird fabuliert, zelebriert, gestöhnt und gejubelt, stumm geschrien und laut geweint.
Der Titel des Briefromans selbst spielt mit Erwartung und Verheißung. Er löst Goethe von seinem klassischen Reisenimbus und transformiert das neapolitanische Sprichwort „Vedi Napoli e poi muori“ in eine ironische, trotzig-lebenshungrige Sentenz. Rom sehen, ja. Aber nicht sterben.
Sommer 2018 zieht Wawerzinek in die Villa Massimo ein. Rom, die Ewige Stadt, die Gassen und Plätze, die Parks und Winkel – sie sollen ihm Inspiration und Muße schenken. Doch zunächst lähmt ihn das Nichtschreiben. Ein namenloser Groll treibt ihn umher, bis die Pandemie Rom und die Welt lahmlegt. Ausgangssperre. CoRoma. Für den Autor wird das Eingesperrtsein zur Flucht ins Innere. Er beginnt zu schreiben.
Ein Roman entsteht – und verschwindet, bevor er das Licht der Welt erblickt. Kein Backup, kein Sicherheitsnetz. Unabsichtliche Selbstsabotage. Für Wawerzinek ein böses Omen. Wenig später reist er nach Berlin, zu „min Skipper“, wie er seinen Arzt nennt. Die Magenspiegelung bringt die Diagnose.
„Es ist Krebs.“
Er geht zu Boden, wird angezählt, beschließt, dies soll nicht der letzte Gong sein. Die Krankheit nennt er „min Schietkrätz“, entreißt ihr so das Drohgebärdenhafte. Seine Sprache wird zum Widerstand, zum Atem.
Ellipsenartige abgebrochene Sätze, fragmentierte Rhythmen, ein Text der klingt wie hastige Atemzüge, ein Gedankenschwall in Stromschnellen.
„Bin allein im Flur, auf weiter Flur.“
Das „Ich“ tritt oft zurück, was die Aussagen allgemeingültiger macht, fast zu einer universellen Erfahrung.
Neben allem Dunkel bleibt Platz für das Spielerische. Wortschöpfungen wie „Vill-A-Restaurant“, „Vatis Kahn“ oder „Panische Treppe“ zeugen von Wawerzineks unerschöpflicher Sprachlust.
Mal kindisch verspielt, mal ironisch übermütig, mal belesen und anspielungsreich. „Bin umklöppelt von Wortkugelei“ (S. 15) heißt es, und man glaubt es sofort. Immer wieder schimmern Zitatpartikel auf .
Goethe, Hilbig, Wunderlich sin lichte Begleiter, , die das Gefühl des Lesenden beschwingen.
Das Buch ist autofiktional, eine intime Verdichtung von Erlebtem und Erfundenem. Es führt zurück in die Kindheit, zur Großmutter, ins Kinderheim, und verbindet diese Erinnerungen mit der existenziellen Gegenwart der Krankheit.
Die Schilderung der Chemotherapie ist schonungslos. Benennt körperliche und seelische Ausfälle, die Flucht in die Isolation. Wawerzinek zeichnet das Bild eines Mannes, der sich wie ein Kosmonaut in einer Raumkapsel ins All der eigenen Ängste treiben lässt . So losgelöst, dass Joachim Witts Goldener Reiter aufsummt.
Rom sehen und nicht sterben ist ein Gewebe aus Gleichnissen, ein Kondensat von Erfahrung und Sprachlust. Es ist existenziell und verspielt zugleich, getragen von einer Sprachmagie, die sich dem Trauma widersetzt. Wawerzinek schreibt, um nicht zu verstummen, und verwandelt das eigene Leiden in Literatur.
Dass dieses Buch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises steht, wirkt folgerichtig. Es ist das Werk eines Wortzauberers, der sich schreibend neu erfindet und dabei das scheinbar Unaussprechliche in Sprache verwandelt.


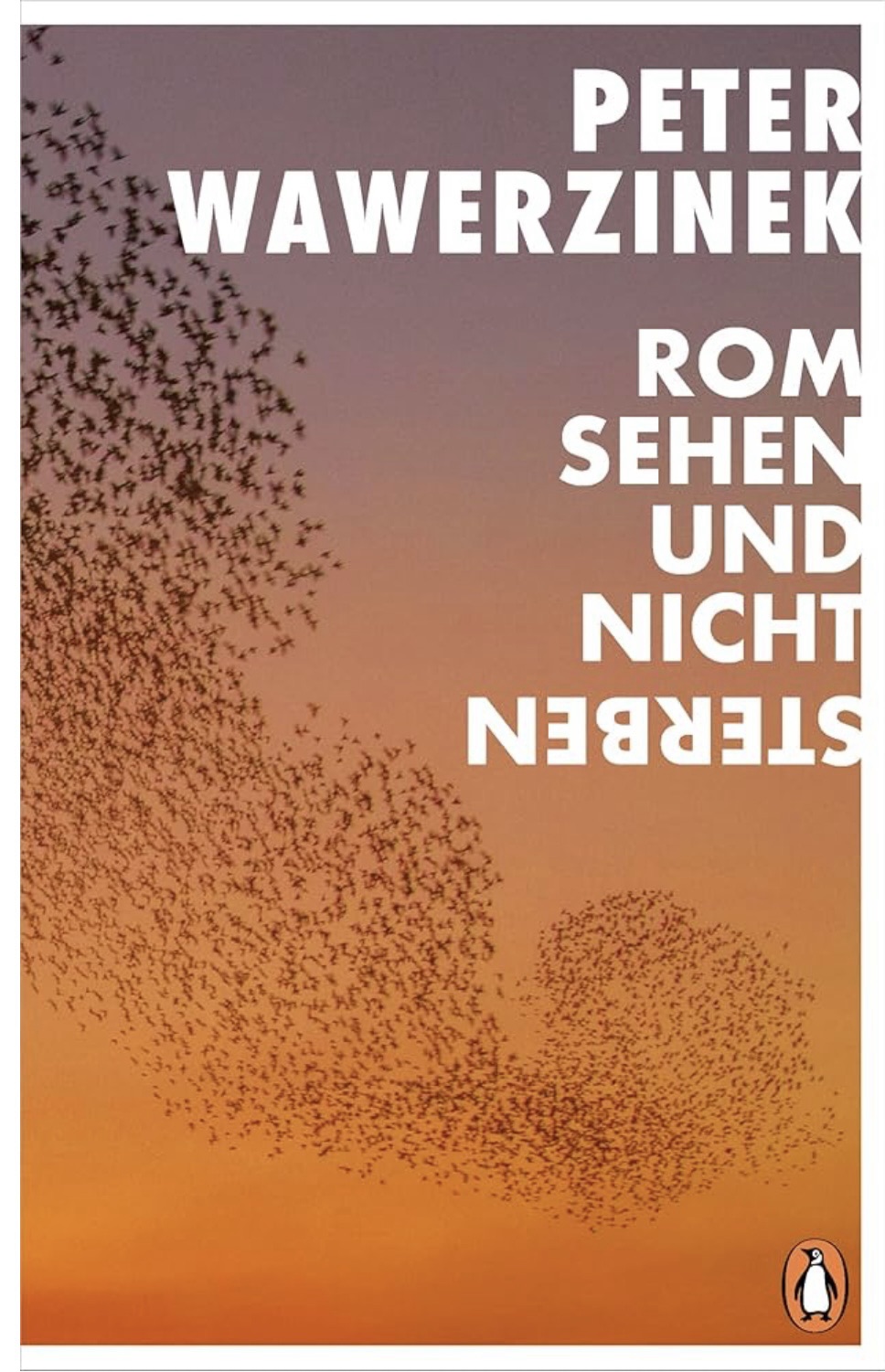
[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…