„Sie wollte nicht weg, konnte nicht bleiben. Seite 391
Die Schwarzgeherin von Regina Denk ist ein Roman der Enge, einer Enge der Topografie, vor allem aber der inneren Verfasstheit in einem Alpental.
In den ersten Kapiteln entfaltet sich ein Dorf, dessen Moral so dicht ist wie der Nebel zwischen den Höfen, die sich an die Bergflanken klammern. Gottesglaube liegt schwer über allem, durchsetzt von Aberglauben und unerschütterlichen Traditionen. Sparsamkeit, Bescheidenheit und Fleiß gelten als höchste Tugenden, doch sie sind nicht aus Milde geboren, sondern aus Mangel. Gegönnt wird niemandem etwas, am wenigsten sich selbst.
Die Gemeinschaft der Oberberger zeigt sich besonders hart zu den Frauen. Solidarität existiert kaum; Weibsbilder gelten nichts, nicht einmal untereinander. Sie sind Gebärende, funktional wie das Vieh im Stall, Teil eines Systems, das wenig fragt und viel verlangt. Die Natur steht diesem Leben nicht tröstend gegenüber, sondern oft rücksichtslos. Sie begleitet die Erzählung wie ein düsteres Requiem.
Regina Denk erzählt mit wechselnden Perspektiven. Sie setzt eine Erzählerin aus dem Jetzt ein, die einem Fremden die Geschichte der Schwarzgeherin berichtet. Einer Wilderin, einer Wilden, die sich den Gesetzen und Regeln des Dorfes nicht beugen wollte, die frei sein wollte wie das Steinadlerweibchen, das über ihr durch die Lüfte rauschte. Diese zweite Stimme schafft Distanz und Nähe zugleich und macht die Lesenden zu Mit-Hörenden.
Theres verliert früh ihre Mutter. Sie stirbt im Kindbett, mit ihr der letzte Sohn. Da der Hof des Lachermeyer nun ohne Erben dasteht, verabreden die beiden Großbauern die Hochzeit ihrer Kinder. Ohnehin sind sie schon viel beisammen, die Theres und der Leopold vom Xantnerhof. Eine Verbindung, die aus einer Kinderfreundschaft erwachsen soll.
Zu einem ersten dramatischen Kulminationspunkt wird das Osterfest. Während es religiös für Erneuerung steht, markiert es für Theres den drohenden Verlust ihrer Selbstbestimmung. In der Kirche sitzt sie zwischen den Xantnerfrauen in der ersten Reihe, ein Bild vorweggenommener Zugehörigkeit und zugleich stiller Auslöschung. Sie weiß: Mit dem Übergang auf den Hof wird ihre Stimme verstummen. Was sie sich beim Vater mühsam an Freiheit erkämpft hat, wird in der Ehe mit Leopold verloren gehen; gemäß der alten Ordnung wird sie „in seinen Besitz“ übergehen.
Die Begegnung mit dem Fremden beim Ostertanz durchbricht diese Erstarrung. In seinen grünen Augen erfährt Theres eine nie gekannte Erregung, eine Versuchung jenseits dörflicher Regeln, ein Versprechen von Freiheit und Abenteuer. Trotz ihrer Verlobung erklärt er sie selbstbewusst zu der Seinen, eine Grenzüberschreitung, animalisch und berauschend. Die Autorin verstärkt diese Dynamik durch die Allegorie der sich findenden Adler: Balz, Wagnis und Überlebensinstinkt verbinden Mensch und Tier in einem Rausch des Anfangs.
Der Fremde, Xaver, erscheint als Gegenfigur zur dörflichen Ordnung: ein Zugereister ohne Herkunft, Handelsvertreter auf Durchreise, scheinbar frei von Regeln. Diese Freiheit fasziniert Theres. Er verfolgt sie offen, verführt sie, verspricht den Ausbruch.
Doch die Metaphern weisen früh den Weg. Theres ist der zappelnde Fisch an der Angel, die Maus vor der Katze. Sie verwechselt Lust mit Liebe, Begehren mit Bindung. Trotz der unübersehbaren Machtasymmetrie lässt sie nicht ab, opfert Freundschaften und verdrängt alle Warnzeichen.
Durch den geschickten Wechsel der Zeitebenen begegnen wir der jungen wie der alten Theres nun als Schwarzgeherin. Wir begleiten ihren Lebensweg und sehen, wie auch sie hart wird und wortkarg, abgeschliffen wie ein Kiesel, der zu lange im Wasser lag. Sie hilft den Menschen im Dorf mit ihrem heilkundigen Wissen, obwohl sie mit keinem von ihnen etwas zu tun haben will. Sie rettet Leben und doch wissen alle: Sie ist keine von Gott Gesandte, keine Heilige. Ihr Regelbruch bleibt unvergessen und unverziehen.
Sie ist eine Ausgestoßene, eine Vogelfreie. Schutz für eine Frau gibt es nur innerhalb der patriarchalen Ordnung. Freiheit und Dazugehören jedoch schließen einander aus. Es bedarf einer eigenen Entscheidung, unter dem Joch hervorzukriechen und einer großen Portion Mut, diese Freiheit einzufordern. Die Schwarzgeherin widerspricht dabei jeder romantischen Verklärung: Beides zugleich, Freiheit und Zugehörigkeit, ist nicht zu haben.
Regina Denk ist mit „Die Schwarzgeherin“ ein atmosphärisch dichtes, hochspannendes Leseerlebnis gelungen. Mit großer Eindringlichkeit zeichnet sie das harte Leben der Bergbauern nach, ihr Ringen mit der Natur und ihr gleichzeitiges Aufgehen in ihr. Sie entwirft ein intensives Bild von lebenslanger Liebe und überbordendem Freiheitsdrang, von Hoffnung und Selbsttäuschung und von einer Gemeinschaft, die nach innen verhärtet und trotzdem solidarisch ist. Getragen wird dieser Roman von starken, widersprüchlichen Figuren, denen man sich bis zur letzten Seite schmerzhaft nah fühlt und von denen man sich am Ende nur widerwillig löst.


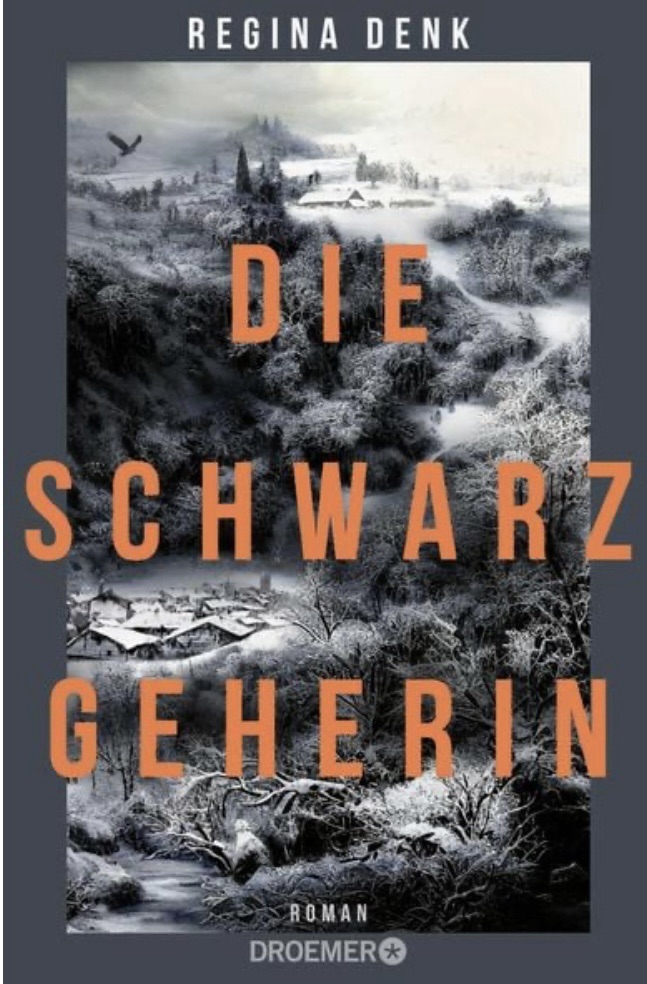
[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…