„Selbst in diesen Tagen der bleiernen Schwere war etwas an ihr, dass ihn erreichte, wenn nichts anderes zu ihm durchdringen konnte. Seite 69
Es beginnt mit einem Riss. Nicht im Gefühl, sondern im Gummi. Ein banaler Unfall, der sich binnen Sekunden in eine existentielle Frage verwandelt: Notfallapotheke, Pille danach und dann dieser Satz, der alles verschiebt: „Und wenn wir ein Kind hätten?“
In diesem Moment kippt das Gleichgewicht. Aus der Leichtigkeit des Begehrens wächst die Schwere der Möglichkeit.
Er sieht sofort Bilder. Eine Bande Gesetzloser mit seiner Wahlfamilie Luisa und ihrer Tochter Ronya und gemeinsamen Kindern.
Romantik als Gegenentwurf zur Ordnung und Luisa lächelt. Vorerst. Denn was als rosarote Projektionsfläche beginnt, wird zur Belastungsprobe: Der Kinderwunsch, erst Phantasie, dann Forderung, verwandelt Lust in Druck, Freude in Schmerz.
Die Beziehung gerät an den Rand des Abgrunds.
Köhler erzählt diese Geschichte nicht linear, sondern in Verschiebungen und Rückblenden. Wechselnde Zeitebenen und Perspektiven lassen beide Protagonisten zu Wort kommen, doch nicht mit gleicher Lautstärke.
Davids Stimme ist die deutlich ausgeprägtere: offen, tastend, verletzlich. Sie führt die Lesenden tief in seine Gefühlswelt, macht sein Bemühen um Ronya nachvollziehbar, ja rührend. In seinem Wunsch, dazuzugehören, liegt immer eine leise Tragik.
Luisa wird nicht als verletzliche Gegenspielerin gezeichnet, sondern als Figur der Zumutung. Ihre Schroffheit ist kein Charaktereffekt, sondern ein Arbeitsmodus: Sie sichert sich ab, oft auf Kosten von Nähe.
Entscheidungen trifft sie kühl, Worte setzt sie scharf, Rückzüge erfolgen abrupt. Dass sie damit David verletzt, scheint sie in Kauf zu nehmen. Nicht aus Grausamkeit, sondern aus einer konsequenten Selbstbehauptung heraus, die wenig Raum für Ausgleich lässt.
Verständlich wird Luisa dort, wo Köhler ihre Mutterrolle ernst nimmt: im chronischen Zeitmangel, im schlechten Gewissen gegenüber dem Kind ebenso wie gegenüber der Arbeit, in der Erfahrung, immer im Defizit zu sein.
Ihr Beharren auf einer gerechteren, geschlechterneutral gedachten Rollenverteilung ist kein theoretischer Anspruch, sondern Ausdruck eines erschöpften Körpers und eines überdehnten Alltags.
Was einst als beiläufige Begegnung begann – ein Urlaubsflirt, geboren aus Angst und Eskalation – gewinnt erst Jahre später erzählerische Dichte. Das Wiedersehen ist kein romantischer Neubeginn, sondern ähnelt einem vorsichtiges Antasten an das, was vielleicht noch ist.
Erst hier setzt Köhler zur eigentlichen Erzählung dieser Beziehung an: fragmentarisch, widersprüchlich, nahezu alltäglich.
Der Roman spart weder Glück noch Zumutung aus. Köhler verdichtet die Ereignisse in seinen „Bildern“
Die Schicksalsschläge stehen als herausfordernde Höhepunkte eines ohnehin instabilen Gefüges.
Sprachlich greift er dabei zu Sätzen von großer Endgültigkeit . Es sind definitive Sentenzen, die wir als Ewigkeitsformeln auf jedem Blockbuster Hollywoods kennen und die auch hier ihre kalkulierte Wirkung nicht verfehlen.
Dieses Spiel mit den emotionalen Wiedererkennen Zehn Bilder einer Liebe dadurch nicht zu einem nüchternen Protokoll einer Beziehung verblassen, sondern macht daraus ein Buch, das Erinnerung aktiviert an eigene Entscheidungen, Versäumnisse, Verletzungen und Lieben.
Es ist das an die Oberflächliche holen, von dem, was Leserinnen und Leser längst mit sich tragen.
Deshalb trifft der Roman präzise einen Nerv unserer Gegenwart.


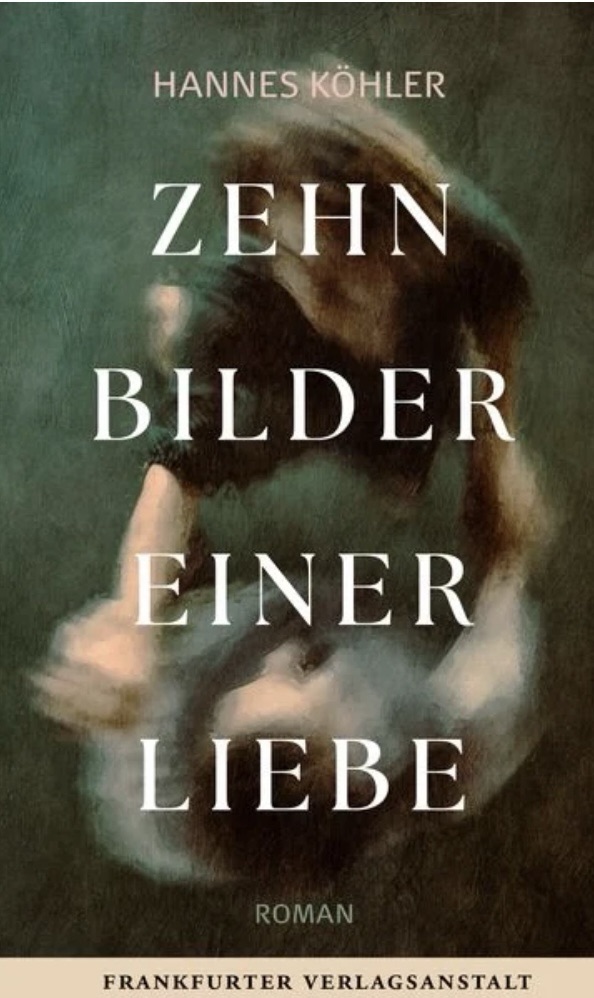
[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…