„Gab es eine Mehrzahl von Inferno?“ S. 127
Es gibt Bücher, die riechen nach der Zeit, in der sie spielen. Nach Bohnerwachs und Nivea-Creme, nach dem feuchten Dunst der Waschtage, der nicht nur Wäsche, sondern ganze Lebensentwürfe durchweichte. Schwebende Lasten von Annett Gröschner ist ein solches Buch. Es erzählt nicht bloß eine Geschichte, sondern hebt die Sedimente des 20. Jahrhunderts auf, schichtet sie neu und macht sichtbar, wie aus Blumenerde und Asche Geschichte wird.
Gröschner verankert ihre Protagonistin Hanna in einem Leben, das aus scheinbar kleinen Dingen besteht: Brotkasten, Brotbüchse, die verlässliche Kittelschürze. Worte, die heute wie Fossilien wirken, rufen aber sofort Erinnerungen wach – an Küchen, die im Winter nach Kohle rochen, an Gespräche, die im Dampf des Einkochens geführt wurden. Es sind „Worte aus einer anderen Zeit“, und Gröschner weiß um ihre Macht.
Die Autorin wählt eine klare, fast spröde Sprache. Keine Ornamentik, kein Pathos. Alles andere wäre hier fehl am Platz, ist mit Blick auf Hannas Leben sagen. Und doch, gerade in dieser Einfachheit liegt eine Wärme, die Nähe schafft. Wenn die Jahre über Hannas Gesicht Furchen ziehen, dann nicht in großen Metaphern, sondern in feinen Linien:
„Später wurden die Falten noch länger, zogen sich über Hannas Mund und verliefen auf Kinnhöhe wie ein Delta, was ihrem Gesicht, wenn sie nicht lachte, etwas Verdrießliches gab. …Immer feiner wurden mit den Jahren die Verästelungen um die Augen herum, vor allem ihre Lachfältchen waren stark ausgebildet, jenseits der fünfzig erstrecken sie sich fächerförmig von den Augenwinkeln zu den Ohren.“
Ein Satz wie dieser ist Beobachtung und Zärtlichkeit zugleich. Kein Lamento, sondern das stille Protokoll des Lebens.
Die Kapitel beginnen mit Blumenbeschreibungen – inspiriert vom Kunstwerk Ambrosius Bossaerts, in dem neben Blüten auch kleines Getier kriecht. Diese Flora fungiert als Resonanzraum, als ein poetisches Gegengewicht zu den grauen Jahren der Nachkriegszeit und des Sozialismus. Blumen, die im März besonders bitter wirken:
„Die Blumenproduzenten verfluchten Clara Zetkin dafür, dass der Frauentag auf ihre Initiative hin auf den Früh März gelegt worden war. Hätten die kämpferischen Frauen nicht ahnen können, dass es im kommunistischen Paradies keine Blumen mehr geben würde?“
Ein Satz, der Geschichte in eine ironische Geste fasst – und zugleich den Mangel spürbar macht, der sich bis in die Rituale erstreckte.
Gröschner schreibt einen fast linearen Roman, durchsetzt mit Einschüben in die Zukunft, kleinen Sneak Peeks, die ahnen lassen, wohin all das führen wird: Vom Zweiten Weltkrieg über den Aufbau und die Agonie der DDR, vom Mauerbau bis zu Sportdoping, Stasi und Republikflucht – und schließlich in ein vereintes Deutschland, das seine eigenen Zumutungen bereithält.
„Im Kapitalismus stirbt die Individualität, weil alle individuell sein wollen.“ (S. 262)
Das ist nicht nur ein Aphorismus, sondern auch ein Spiegel für Hannas Lebensweg. Eine Frau, die sich nie zur Parole eignete und gerade dadurch zur Zeugin der Zeit wurde.
Am Ende, wenn von „237 Sträußen“ die Rede ist, klingt nicht bloß eine Zählung an, sondern eine Bilanz. Es ist ein unglaublich schönes, wehmütiges Ende, das die Blumen wieder ins Zentrum rückt, diesmal nicht als Schmuck, sondern als stille Sprache des Abschieds.
Schwebende Lasten ist ein Buch, über die kleinen Ordnungen inmitten großer Umbrüche, über die Lasten, die wir nicht abwerfen können, weil sie längst in uns schweben. Es ist ein Buch, das auf der Longlist des Deutschen Buchpreises zu recht seinen Platz gefunden hat.


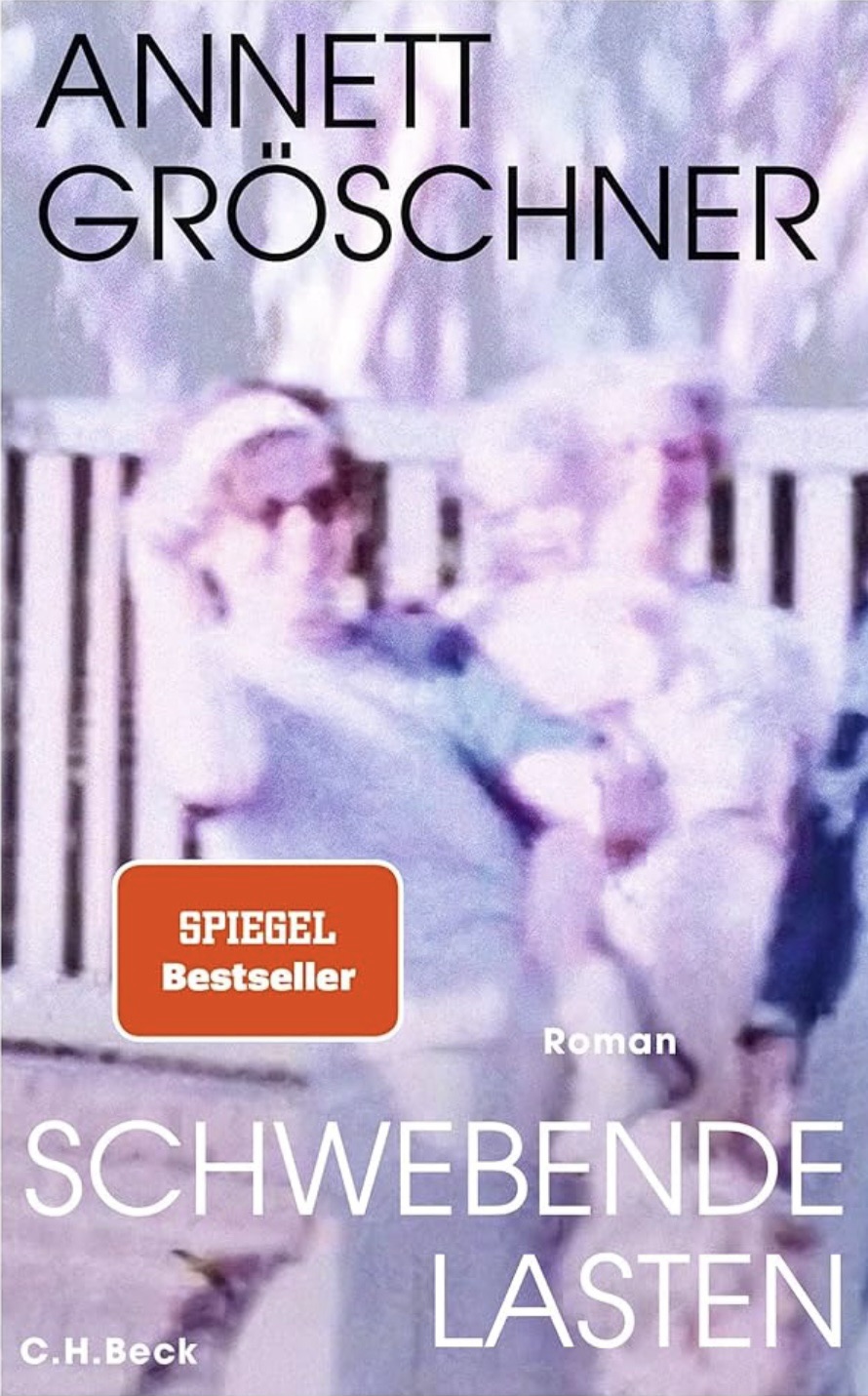
[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…