„Die Blätter färben sich herbstlich, Papa ist immer noch nicht tot.“ Seite 71
Wie kann sie nur solche Sätze schreiben. Sie klatschen einem wie eine flache Hand ins Gesicht. Man hält inne, erschrickt, schüttelt ungläubig den Kopf – und liest weiter. Nefeli Kavouras traut sich hier etwas. Sie beginnt nicht mit einem langsamen Herantasten an das Thema Krankheit und Abschied, sondern mit einem Satz, der das Unerträgliche lakonisch konstatiert:
„Die Beerdigungsgäste sind gegangen und wir wissen nicht, was wir mit den Kuchenresten anfangen sollen.“ S.5
Was für eine starke Eröffnung, mit einem mächtigen ersten Satz.
Der Roman erzählt von einer Mutter-Tochter-Beziehung im permanenten Ausnahmezustand. Georg, der Vater, erkrankt plötzlich. Zunächst scheint es eine Episode zu sein, eine Unterbrechung. Er ist kurz krank, kurz weg, dann wird alles weitergehen wie zuvor. Doch das „Davor“ zerfällt schneller, als es den Figuren lieb sein kann. Bevor er multimorbid war, kochte er Pastasoße, und er kochte gern. Danach ist er „der Mann mit Pflegestufe vier“.
Fast zehn Jahre Intensivpflege folgen, ein Krankheitsprozess, der nicht nur den Körper Georgs, sondern auch die Seelen der Zurückbleibenden auslaugt.
Wie Blätter eines Abreißkalenders entfalten sich kurze Kapitel mit prägnanten Überschriften. Abwechselnd berichten Tochter Lea und Mutter Ruth vom Davor und Danach. Die Struktur ist fragmentarisch, schnörkellos. „Pflegejahre sind Jahre ohne Details. Alles wird im Groben zusammengehalten, für mehr reicht es nicht.“ Seite 70
Dieser Satz beschreibt nicht nur den Inhalt, sondern auch die Poetik des Romans. Kavouras arbeitet mit einer lakonischen Sprache. Sie schreibt in kurzen Hauptsätzen, mit sparsam gesetzten Adjektive. Pathos wird konsequent verweigert. Emotionalität entsteht aus der Reibung zwischen existenzieller Erschütterung und sprachlicher Kargheit. Gerade die Zurückhaltung erzeugt hier Intensität. Was allerdings fast den ganzen Roman durchzieht, ist Wut.
Lea ist selbst noch unfertig und soll mit etwas fertigwerden, das kein Mensch vermag. Ihre Wut entlädt sich gegen die Mutter. „…wer will schon einen süßen kranken Vater oder eine überforderte Mutter,…“ S.11
Die verbalen Schläge der Tochter treffen Ruth ins Mark.
Das Band zwischen Mutter und Tochter wird immer brüchiger. Lea verstummt zunehmend, ekelt sich vor der sterbenden Hülle des Vaters. Gleichzeitig spürt sie, wie die Mutter sie ausgrenzt. Diese tut dies nicht aus Lieblosigkeit, sondern aus Erschöpfung. Ruth wäre gern da für ihre Tochter, doch die Pflege fordert all ihre Kraft.
„ …1000 Tieraugen gucken mich an, alle wollen gefüttert werden. Sie wollen mich nicht fressen, sie sind nicht bedrohlich, aber ich weiß, ich bin die, die sich kümmern muss, und ich kann nicht. Seite 94
In dieser Metapher verdichtet sich die Überforderung der Pflegenden: Die Verantwortung ist allgegenwärtig, ist absolut. Es gibt kein Entrinnen, keine Pause, keine Belohnung. „Wenn jemand Geburtstag hat, gibt es Kuchen, aber wenn der eigene Ehemann einem wegstirbt, gibt es gar nichts.“ Seite 75
Der Roman zeigt die soziale Unsichtbarkeit langwierigen Sterbens. Die Einsamkeit die dadurch auch beim Pflegenden entsteht.
Die Wandlung Ruths erzählt Kavouras in einer klugen Parallelführung mit Georgs Arbeitszimmer. Der Raum wechselt seine Funktion wie sie die ihre: vom Ort der Entwürfe zum Krankenzimmer, vom Krankenzimmer zum Sterbezimmer. Wo einst Pläne ausgerollt und Linien gezogen wurden, steht nun ein Pflegebett; wo Zukunft gedacht wurde, gibt es keine mehr.
Mit jedem Möbelstück, das weicht, mit jedem medizinischen Gerät, das einzieht, verliert nicht nur der Raum seine ursprüngliche Bestimmung, sondern auch Ruth ein Stück ihrer früheren Identität als Ehefrau und Mutter.
Sie wird zur Organisatorin, zur Pflegenden, zur Verwalterin des Verfalls. Der Raum schrumpft, und mit ihm ihr Möglichkeitsraum.
In der Mitte des Buches entsteht beinahe der Eindruck, die Geschichte sei auserzählt. Die Chronik des Verfalls scheint abgeschlossen, die Wut erschöpft. Doch Kavouras überrascht. Sie greift, fast kommentarlos, zum magischen Realismus. Das Unreale tritt in die realistische Welt ein, ohne besonders markiert zu werden.
Mit diesem Kunstgriff verleiht die Autorin Ruth und Lea eine neue Dimension. Die Transformation ermöglicht Bewegung, wo zuvor nur Erstarrung war.
Sie schafft eine andere Perspektive auf Verlust und eröffnet einen Weg zur vorsichtigen Annäherung zwischen Mutter und Tochter.
Die Einführung des Surrealen geschieht abrupt; man braucht als Lesender einen Moment der Gewöhnung. Doch gerade dieser Bruch zwingt zur Neujustierung der eigenen Lektüreerwartung.
Am Ende bleibt Raum für ein eigenes Szenario, eine eigene Deutung.
„Gelb, auch ein schöner Gedanke“ zeigt Pflege als Erosionsprozess. Kavouras erzählt vom Zerreiben zweier Frauen an einer Dauerbelastung, von der leisen, trotzigen Restbindung, die selbst im Ausnahmezustand nicht ganz verschwindet, sich verändert und neu justieren muss.


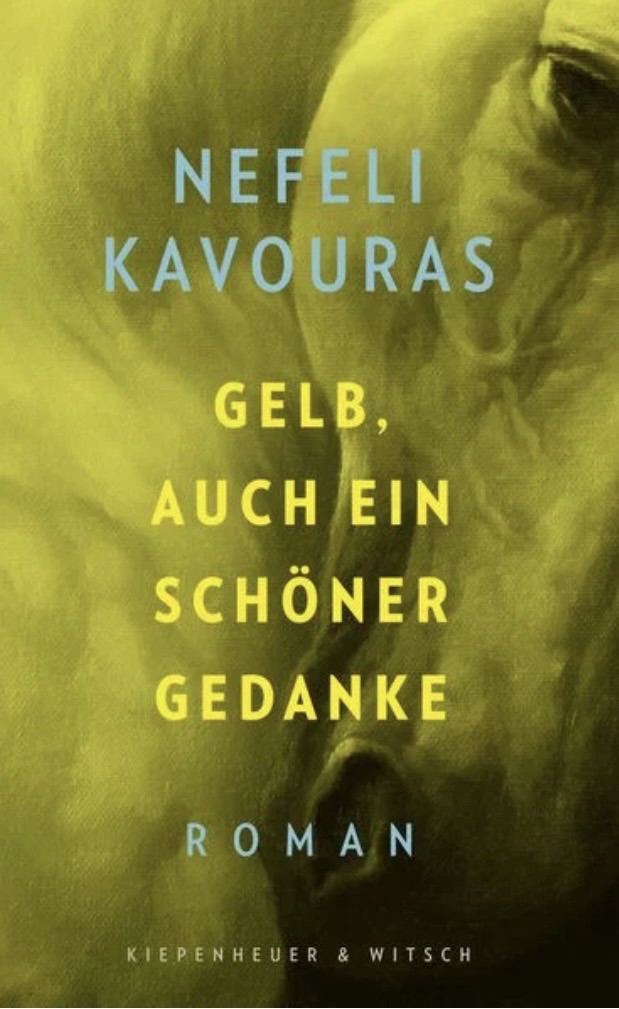
[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…