„Mein ganzes Leben lang suche ich schon nach Verbindung.
Aber wo soll ich suchen, wenn ich nicht weiß, welche Verbindung ich finden möchte?“ Seite 8
Ich öffne dieses Buch wie eine Tür zu einer Insel, die es nicht geben dürfte – und finde mich doch in meinen eigenen Rissen und Träumen wieder. Kaum angelaufen, schnürt mir Webers salzige Luft schon die Kehle zu, während ihr Sprachglitzer unverschämt in der Sonne funkelt.
Die Ausgangslage ist scheinbar schlicht: Dimora, jene launische Insel irgendwo zwischen Märchen und Metropole, sammelt Gestrandete ein – vom Tomatenbauern bis zur Friedhofsflaneurin. Jede der neun Kurzgeschichten wirft eine neue Leine aus, doch nie wissen wir, ob sie trägt oder reißt. Zwei Sätze genügen, und wir stehen mit klammen Fingern im Nichtwald, während die Brandung schreit.
Was treibt diese Figuren an? Sehnsucht, natürlich – aber Weber legt sie unter ein Vergrößerungsglas, bis wir die haarfeinen Brüche sehen. Da ist der Zeitungsausträger, dem im nächtlichen Stromausfall grüne Augen aus Briefkästen entgegenfunkeln und „fingernagellose Finger“ seine Lieferung verschlingen. Oder der Schrotthändler Takase, der in einer Halle plötzlich in ein schwarzes Loch stürzt, das nach „Seelenschrott“ flüstert . Jeder Text treibt ein Motiv vor sich her – das Verlorene, das Verschluckt-Werden, das nie ganz Fassbare – und die erzählerische Kamera schwenkt mal zärtlich, mal unerbittlich.
Weber schreibt, als würde sie die Sätze mit einer Grubenlampe aus dem Fels brechen: starke Verben, Bilder, die knistern wie Draht im Sturm. Wenn „Baumskelette wie Leichname ohne Füße“ am Wegesrand kauern , dann wird das ökologische Grauen zur poetischen Kulisse. Und doch platzt zwischendurch Ironie hervor – leise, aber spitz: „Blau ist die schnellste Farbe“, schnauft der Eislauf-Sieger im Fernsehen, während der Tomatenbauer eine Pavlova rollt, die ihm im Traum zur Riesenheidelbeere mutiert. Lachen erlaubt, Nachbeben garantiert.
Kann eine Kurzgeschichtensammlung gesellschaftliche Relevanz haben? Unverhohlen ja: In Zeiten, in denen Klimakrise, Migration und digitale Entfremdung uns die Koordinaten rauben, stellt Dimora die unbequeme Frage, was Heimat heute noch bedeutet – und wem sie gehört. Wer erinnert sich, wenn niemand mehr zurückkehren darf? Ist Identität eine Postkarte oder eine Wunde? Die Texte tänzeln um diese Fragen, ohne sie zuzunähen.
Doch Weber gönnt uns auch zarte Zwischentöne: ein Kuss am Felsrand, der riecht wie Algen und Hoffnung; ein Mädchen, das mit Zauberersamen am Briefkastenbrett Zukunft vergräbt. Solche Momente leuchten wie Seeglas im Sand und halten die Schwermut im Gleichgewicht.
Bleibt die Sprache manchmal einen Hauch zu opulent, die Symbolik einen Millimeter zu offensichtlich? Vielleicht. Aber wer behauptet, Sehnsucht müsse minimalistisch sein, hat nie die volle Wucht einer herbstroten Hagebutte gekostet.
Fazit: Dimora entfaltet sich wie eine flüsternde Sturmwarnung – wer bereit ist, im literarischen Treibsand nach Klang, Kante und Trost zu wühlen, sollte dieses Buch unbedingt lesen; wer nur glatten Boden mag, lasse lieber Abstand.
Einzig das minimalistische Cover vermag nicht zum magischen Inhalt zu passen.


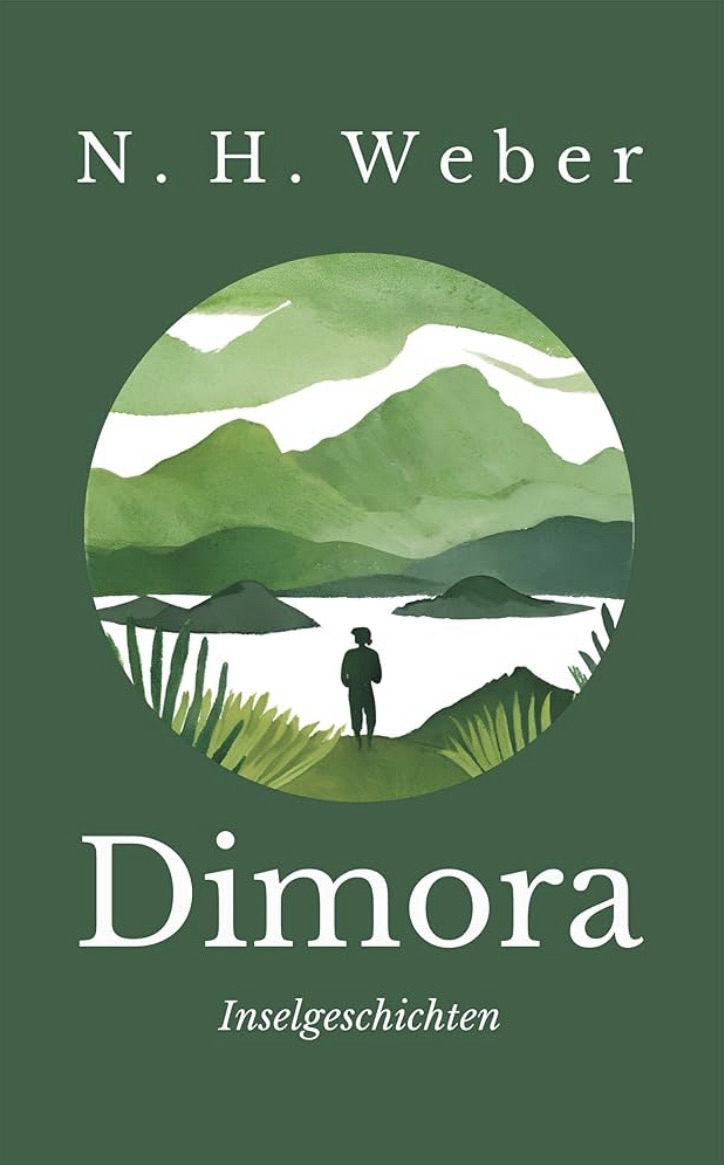
[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…