„Steht nicht an jedem Anfang ein Gedanke?“ Seite 16
Michael Köhlmeier geht autofiktional in seine Jugend zurück – und er tut es mit spürbarer Freude. Er lässt uns die verrauchte Luft der Studentenkneipen atmen, das Stimmengewirr, das Flirren jener Jahre. „Eine Szene wie die in der Lokomotive (einer Studentenkneipe) am Marburger Marktplatz ist ein Diamant in einem Leben aus Sand und man vergisst sie ein Leben lang nicht.“ (S. 21) Doch Köhlmeier belässt es nicht beim funkelnden Stein im Strom der Erinnerung. Warum, so fragt man sich, lässt er die eigene Identifizierung mit dem Bösen zu? Denn nur hierum geht es schlussendlich. Vielleicht liegt darin eine teuflische Freude, sich selbst einzubringen, ein wenig Selbstentlarvung der abgründigen Seiten der eigenen Seele – fraglich, aber denkbar.
Schon die früheste Kindheit des Protagonisten Johann setzt das düstere Fundament des Romans. „Einmal im Leben möchte ich einen Mann töten.“ (S. 14) Das wäre, die Antwort des sechsjährigen auf die Frage nach seinem Lebenswunsch gewesen. Der Vater stellt diese Frage einmal und dann, ohne sie hörbar beantwortet zu bekommen, nie wieder – aus Angst, einer „Ausgeburt“ auf die Welt geholfen zu haben.
Die Erzählung treibt auf das Böse zu wie ein Schiff auf den Mahlstrom. Spätestens in jener verstörenden Dreierbeziehung zwischen Johann, Tommi und Christiane tritt das Unheil unverstellt hervor. Johann lernt in der Enge eines Aufzugs – was für ein vorausschauendes Bild – das Paar kennen. Was sich daraus entwickelt, ist obsessiv, boshaft, vulgär, nicht nahbar. Es ist Alles, nur nicht Liebe. Es ist Begehren, Besitzen, Bestrafen. Eine stumme Antiliebe, ein System aus Verletzungen aus Langeweile, schamlos, ohne moralische Grundsätze.
Und so drängt sich in der Nachschau dem 70 jährigen Erzähler Johann die Frage auf: Wie landen Menschen dort, wo sie in späteren Jahren stehen?
„Was macht die Geographie eines Lebens aus?“ (S. 116) Ist es die unscheinbare Verkettung kleiner Entscheidungen die dort heranführt oder das angeborene Böse. Was trägt zur Erfüllung Johanns Lebenswunsches bei? Ist es philosophisch betrachtet der reine Mangel am Guten? Entspringt es einem Trieb? Oder ist es das Produkt von Gedankenlosigkeit und Routine. Eine Arendtsche Betrachtung der
der „Banalität des Bösen“?
Stilistisch verführt Köhlmeier zunächst mit melodisch-weichen Beschreibungen. Ein Wort wie „Liebe“ ruft ein ganzes Universum auf – Sternenhimmel, Bücher, Musik, eine Frau, den Sohn, den Vater. Ein leichter Lesefluss und kurze, prägnante Sätze so aphoristisch, kalenderspruchartig, „zitierwürdig, die man als Stickbild gerahmt über die Küchenanrichte hängen könnte“ verführen den Lesenden: „Verrücktheiten sind selten. Und was selten ist, ist kostbar.“ (S. 21)
Die Sprache ist voll überraschender Wortgeschöpfe, die innehalten lassen, die man im Munde herumführt, zum Test laut ausspricht mit einem leisen, wissenden Lächeln im Gesicht. „Weiß der Absonderliche, dass er absonderlich war?“ (S. 30)
Doch unter solchen Sentenzen sticht etwas Dunkles, wie der unsichtbare Stachel eines Kaktus, der sich schon längst tief ins Fleisch gebohrt habt.
Die Verdorbenen läuft, getrieben von abgründigen Begierden, unaufhaltsam auf sein dunkles Ende zu. Tod, doppelt, wie vorgezeichnet, längst vorangestellt. Ein Roman, der sich nicht scheut, die Nachtseiten des Menschen zu beleuchten – und dabei immer wieder die schillernden, warmen Lichter der Erinnerung aufflackern lässt.


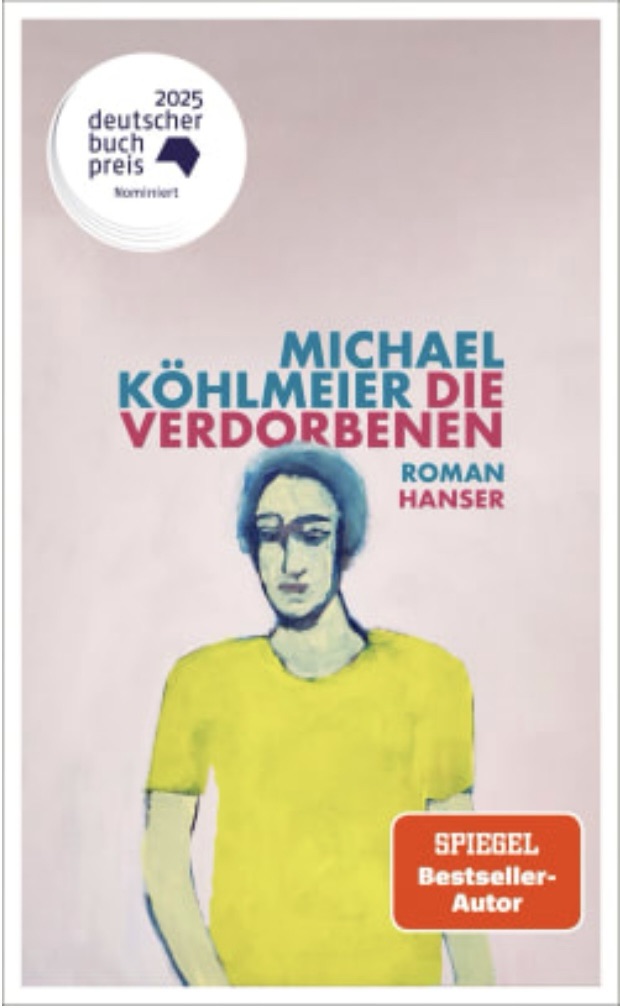
[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…