„Es blieb Übelkeit, das Leiden an dem Übel Mensch und dem, wozu er fähig war.“ Seite 64
Barbara Imgrund gelingt mit Der Wurm ein literarisches Meisterwerk von beeindruckender Verdichtung und ethischer Sprengkraft. Auf nur 150 Seiten entfaltet sich eine Geschichte, die weit über das bloß Erzählte hinausweist. Es ist eine Erzählung über die fortwährende Bedrohung durch den „Wurm“ – ein Sinnbild für Faschismus, Menschenverachtung und die Verführung durch einfache Wahrheiten in komplexen Zeiten.
Im Zentrum steht Martha, 87 Jahre alt, eine gebrochene Frau, die sich auf einen letzten Gang durch ihre Vergangenheit begibt. Was sie durchschreitet, ist nicht nur das topografische Terrain ihrer Kindheit, sondern das moralische Gelände einer Epoche, in der Menschlichkeit zur Schwäche erklärt wurde. Ihr Rückblick wird zur schonungslosen Bilanz einer Zeit, in der „Gerüchte den Berg hinaufwehten“, dann kreischten die Volksempfänger und die rechten Arme folgen nach oben, bis der Tod in Glockenklang gefasst war.
Imgrunds Sprache ist von seltener Schönheit. Melodisch, poetisch, dabei von existenzieller Wucht – sie malt nicht, sie graviert ihre Sätze in das Gedächtnis. Die Bergwelt ist mehr als Kulisse: Sie ist Spiegel und Gegenbild, ein Ort ursprünglicher Ordnung und zugleich des Abgleitens. Hier vollzieht sich die schleichende Entmenschlichung in langsamen, kaum wahrnehmbaren Bewegungen – genau wie der „Wurm“, der sich bergan frisst.
Der Roman ist mehr als eine historische Erzählung – er ist eine Zeitdiagnose, ein Weckruf, eine literarische Intervention. Imgrund verweigert sich jeder plakativen Didaktik und erreicht gerade dadurch ein hohes Maß an ethischer Klarheit. Ihre Prosa stellt Fragen, zwingt zur Auseinandersetzung, und sie lässt uns spüren, dass das Grauen nicht vergangen ist – es ist lediglich getarnt, bereit, erneut zuzuschlagen.
Das Motiv der Schuld zieht sich wie ein dunkler Strom durch den Text. Martha, die Zeugin des Schreckens, ringt mit ihrem eigenen Schweigen. Die Erinnerung wird zur Anklage und zur letzten Chance auf Versöhnung – nicht mit der Vergangenheit, sondern mit dem eigenen Gewissen. Der Text schreit – manchmal leise, manchmal ohrenbetäubend – nach Haltung.
Der Wurm ist ein leises Buch mit lauter Wirkung. Es ist ästhetisch brillant, intellektuell fordernd, emotional erschütternd. Wer es liest, wird verändert daraus hervorgehen. Im besten Sinne. Denn es erinnert uns an unsere Verantwortung – nicht nur als Leserinnen und Leser, sondern als Menschen.
„Denn kein Mensch ist es anderen Menschen Herr und kein Volk des anderen Volkes Henker.“ (S. 150)
Ein literarisches Mahnmal. Ein Appell. Eine Verpflichtung.


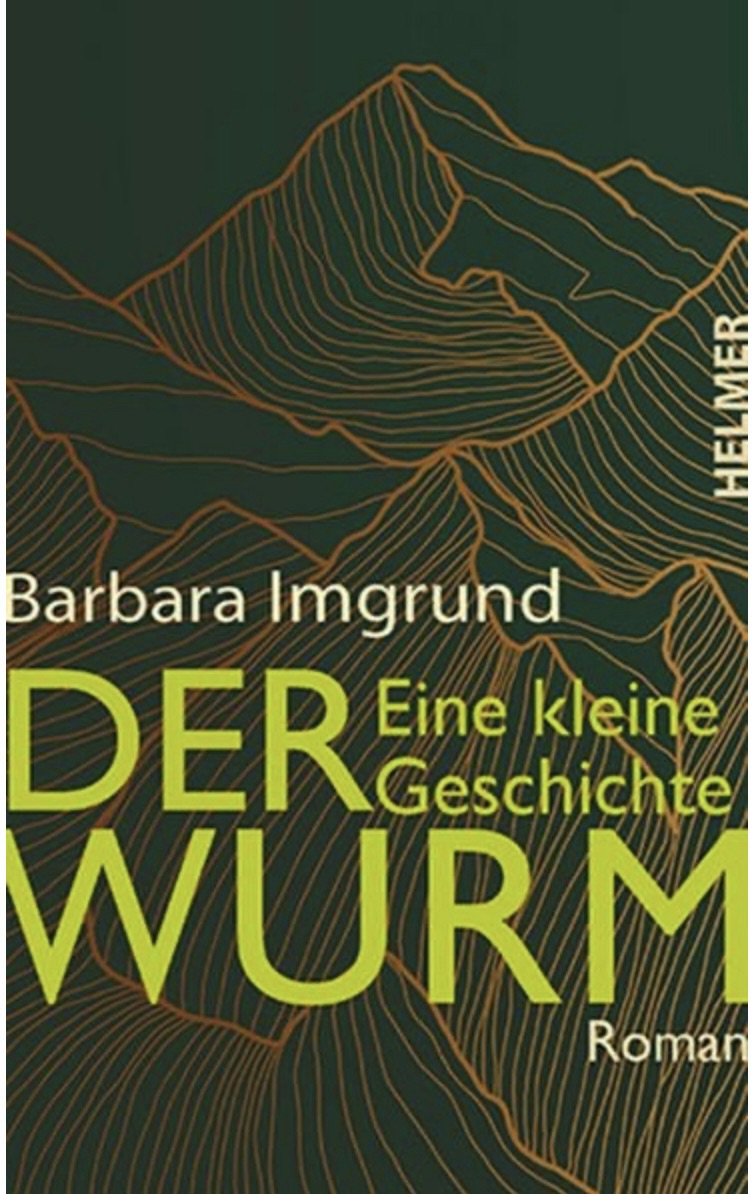
[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…