„Einsamkeit, ohne die Disziplin des Gebets, führt nur zu einer morbiden, Selbstmitleid Geistesverfassung. Seite 173
Es ist ratsam, nach der letzten Seite von Ann Schlees Roman „Die Rheinreise“ einen Moment innezuhalten, ehe man sich Lauren Groffs klugem Nachwort widmet.
Wenn man das Gelesene nachhallen lassen konnte, ist Groffs präzise Einordnung in die viktorianische Epoche, den politischen Umbruch in Preußen und die literarische Verflechtung mit Wagners „Götterdämmerung“ eine Bereicherung. Sie nimmt dann das eigene Denken und Empfinden nicht vorweg, sondern vertieft und erweitert es.
Denn „Die Rheinreise“, 1981 mit dem Booker Prize ausgezeichnet, entfaltet ihre Wirkung nicht im Donnerschlag der Erkenntnis, sondern im leisen Grollen unter der glatten Oberfläche.
Schlee beschreibt in ihrem historischen Roman, der heute vorschnell als „feministisch“ etikettiert wurde, keine Heldin im modernen Sinn. Ihre Charlotte Morrison, eine unscheinbare Mittvierzigerin, hat 24 Jahre lang als Haushälterin einem Mann gedient, den sie bis zu seinem Tod pflegte.
Nach seinem Ableben bleiben ihr ein kleines Vermögen und die bittere Erkenntnis, dass sie fortan nirgends dazugehört. Ihr Bruder, der Reverend Charles Morrison, nimmt sie auf eine sommerliche Rheinreise mit, eine scheinbar harmlose Sommerfrische zur Kräftigung seiner kränkelnden Frau.
Charlotte, Bedienstete, Gesellschafterin, Gouvernante und moralischer Puffer zugleich, wird von ihrer Umgebung geduldet wie ein Stück Möbel.
Ihr Dasein ist biegsam, höflich, selbstverleugnend, eben das genaue Spiegelbild einer Zeit, in der Frauen Tugend durch Unsichtbarkeit bewiesen. Das viktorianische Frauenbild war geprägt von Unterordnung, Häuslichkeit und moralischer Reinheit. Schlee gelingt es, diesen Zustand nicht als bloße historische Kulisse, sondern als seelische Landschaft zu zeigen.
Wie der Rhein selbst fließt dieser Roman gemächlich dahin. Die Beschreibungen der Landschaft, der Burgen, der Städte zwischen Koblenz und Köln wirken wie in Sepiatönen gemalt, verhalten schön, leicht verstaubt, getragen von der träge wogenden Bewegung eines Dampfschiffes.
Wer rasches Vorankommen sucht, wird ungeduldig werden. Gerade die Langsamkeit, die beständigen inneren Dialoge, Traumsequenzen und Strömungen Charlottes, die kein äußeres Pendant erzeugen, verlangen dem Lesenden ein hohes Maß an Muße ab.
Schlee verlangt Geduld, die sie dann mit jener stillen Erschütterung belohnt, die aus dem Verständnis der historischen Zwänge erwächst: Frauen, noch rechtlos, ohne Eigentum, ohne Stimme, gefangen im Korsett moralischer Erwartungen. Erst zwei Jahrzehnte später werden die Suffragetten auf die Straße gehen. „Die Rheinreise“ führt tastend, wie eine innere Vorbereitung auf den Aufbruch, dorthin.
Was Schlee hier zeichnet, ist ein Sittenbild der viktorianischen Gesellschaft, ihrer Steifheit, ihrer Manieriertheit, ihrer erstickenden Etikette. Der Ton ist altmodisch, ja, manchmal nostalgisch verstaubt, und doch wohnt ihm eine subtile Spannung inne.
Es ist die Hoffnung auf Befreiung, die Ahnung, dass unter der bereits aufgeworfenen Oberfläche etwas gärt. Dass Groff im Nachwort die von Schlee geschaffene Parallele zu Richard Wagner betont, ist kein Zufall. Auch hier kündigt sich eine Götterdämmerung an.
So ist „Die Rheinreise“ ein Roman, der sich der Hast unserer Gegenwart widersetzt. Ein Buch, das verlangt, gelesen zu werden, wie man den Rhein betrachten muss, aufmerksam und im Bewusstsein, dass seine Tiefe nur sichtbar wird, wenn man stehen bleibt.


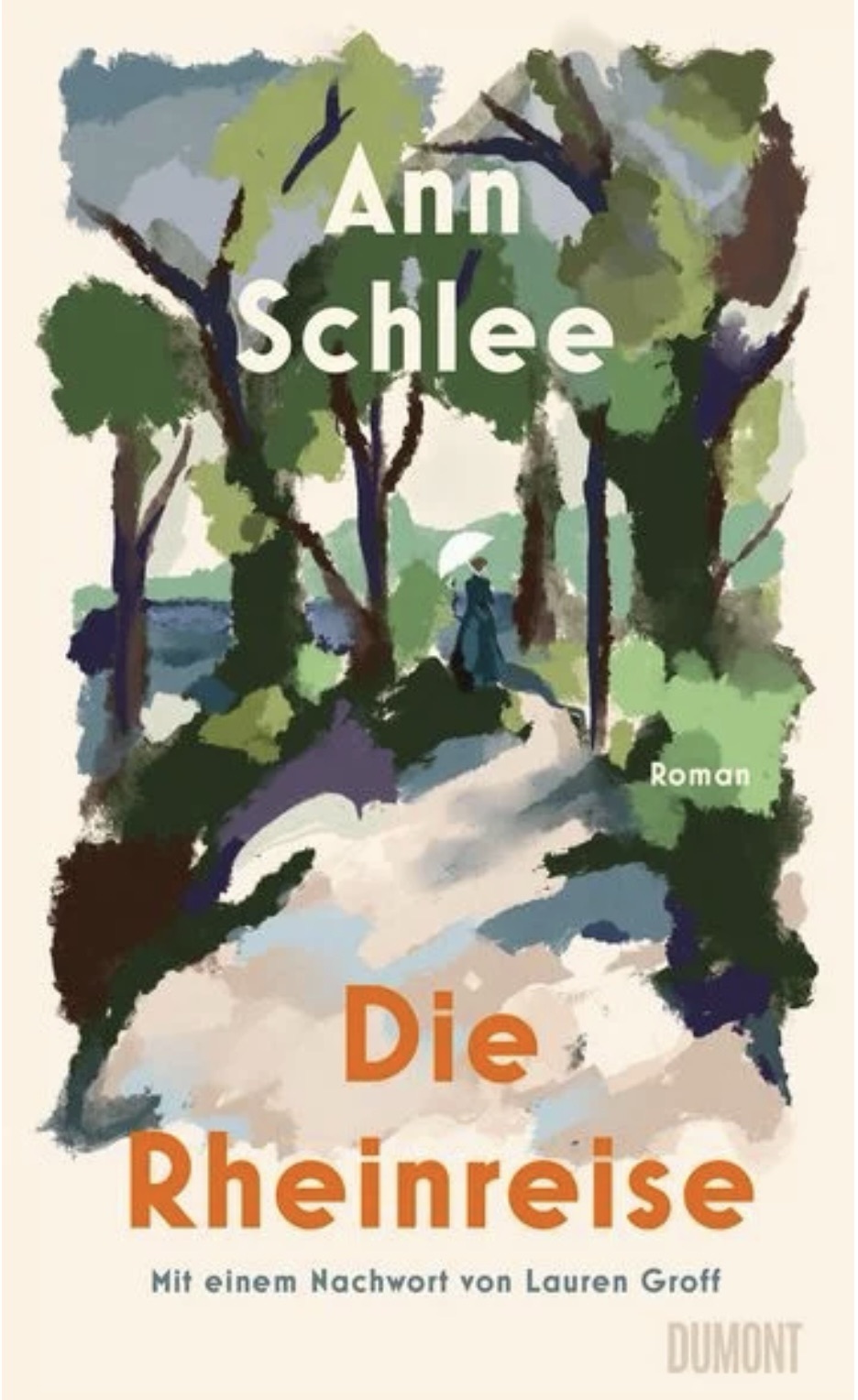
[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…