„Indem Träume zu Waren wurden, ist ein neuer Markt entstanden – und Märkte müssen wachsen.“ Seite 215
Es geschieht selten, dass ein Roman einen so zwingt, dass man die Seiten hastig umblättert, weil man den Fortgang nicht mehr erwarten kann.
Das Dream Hotel von Laila Lalami ist solch ein Buch. Es ist ein literarischer Sog, der uns unaufhaltsam in eine Zukunft zieht, die auf unheimliche Weise aus der Gegenwart gewachsen scheint.
Die Protagonistin Sara T. Hussein, Archivarin am Getty Museum in Los Angeles, Mutter von Zwillingen und Ehefrau ist erschöpft von der Doppelbelastung. Sie hat sich, wie viele, einen sogenannten Dreamsaver implantieren lassen. Ein technologisches Versprechen eine Schlafstörung zu bekämpfen durch nur fünf Stunden produzierten REM-Schlaf.
Doch als Sara von einer Dienstreise aus London zurückkehrt, kippt ihr Leben in eine Schieflage. Ein Algorithmus hat ihren „Risikowert“ über die Schwelle von 500 gehoben. Eine Zahl, hinter der sich die gebündelten Datenspuren ihres Lebens verbergen, ihre finanzielle Lage, familiäre Situation, Reputation, ja sogar ihre Träume.
Was folgt, ist der Albtraum im doppelten Wortsinn. Sara wird aus dem Strom der Einreisenden herausgezogen, in eine Kleinstadt namens Ellis verbracht, eingesperrt in das ehemalige Schulgebäude „Madison“, das nun als Einbehaltungszentrum für Frauen dient.
Dort herrscht die totale Überwachung durch Kameras, Emotionstracker, Wärter:innen und jede Insassinnen trägt eine Neuroprothese, die den genauen Standort vermeldet. Sie sind FUB. Frei, unter Beobachtung.
Selbst ihre eigenen Träume sind dank Dreamsaver nicht mehr privat, sondern dienen als Beweismittel gegen sie.
Lalami schildert eine Welt, in der das „Gesetz zur Verhinderung von Straftaten“ (GVS) herrscht: ein juristisches Konstrukt, das nach einem Massaker eingeführt wurde und erlaubt, Menschen allein aufgrund von Wahrscheinlichkeiten zu inhaftieren. Pre-Crime ist hier keine Metapher, sondern Gesetzestext. Wer träumt, könnte schuldig sein.
Das eigentliche Grauen des Romans liegt darin, wie vertraut all dies wirkt. Die Willkür von Sicherheitsbehörden, die Verschiebung von Grenzen zwischen Kontrolle und Überwachung, die Abwertung von Individuen zu Datensätzen. Das alles ist uns nicht fremd.
Lalami macht sichtbar, dass diese dystopische Zukunft auf der langen Kontinuität von Machtmissbrauch gründet. Vom Streifenpolizisten, der migrantische Körper ins Visier nimmt, bis zur KI, die Träume scannt.
Stilistisch arbeitet der Roman mit einer raffinierten Durchdringung. Offizielle Dokumente, Protokolle, Beurteilungen treten in kursiven Einschüben auf, sie bürokratisieren das Leben und verleihen dem Fiktiven den Anschein des Realen. Zugleich erschüttern Twists die Erzählung, brechen das Vertrauen des Lesenden, lassen ihn zweifeln, was noch Fiktion ist, was schon Realität.
In ihrer Danksagung verweist Lalami auf Charlotte Beradts Drittes Reich des Traums und Foucaults Fall Rivière. Beides historische Zeugnisse der Kontrolle über das Intimste, über Sprache, Körper und Träume. Das Dream Hotel führt diese Tradition in eine nahe Zukunft weiter, die sich erschreckend plausibel anfühlt.
So ist dieser Roman nicht nur eine literarische Dystopie, sondern auch eine brennende Gegenwartsdiagnose. Er zeigt, wie leicht die Schwelle überschritten werden kann, an der wir unsere Freiheit gegen die Illusion von Sicherheit eintauschen. Und er erinnert daran, dass die Albträume von morgen oft aus den Bequemlichkeiten von heute geboren werden.
Ein packendes, beklemmendes, zugleich hochaktuelles Buch.


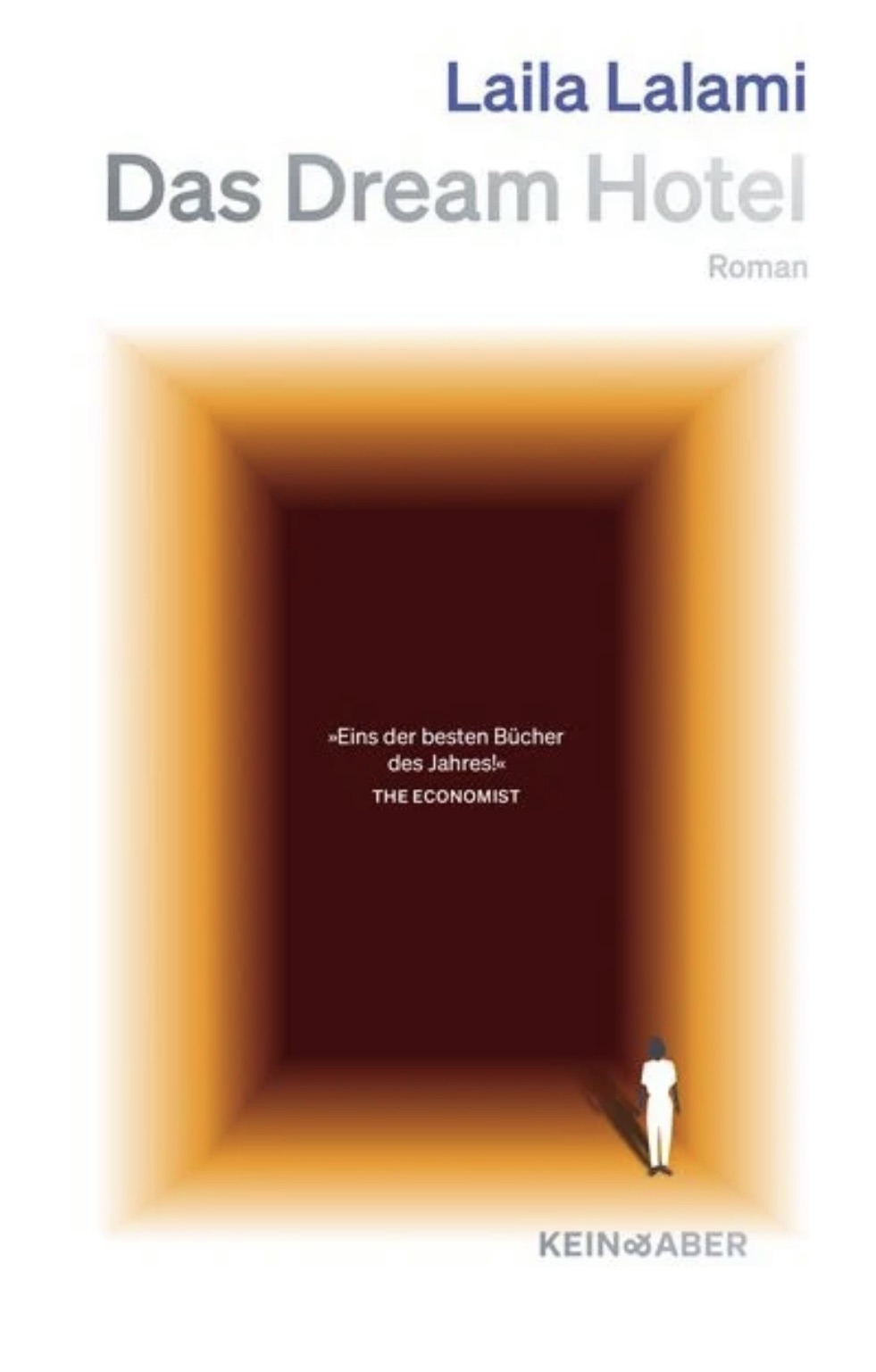
[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…