„Fernweh und Heimweh, Sehnsüchte. Beide fühlen sich an, als habe jemand im Herz ein Fenster offen gelassen, durch das es zieht. Seite 17
Sie hat „einen Schimpfautomaten im Kopf“. Sie „mag Menschen einfach nicht, weil sie Menschen sind,“ beides ist nicht gut für die Verdauung, was ihr bewusst ist.
Das ist Frieda, die Heldin von Arezu Weitholz’ Roman Hotel Paraiso. Und es ist diese gekonnte, fast komische Selbstanalyse, die schon auf den ersten Seiten deutlich macht: Hier spricht eine, die mit der Welt hadert und mit sich selbst gleich dazu.
Frieda fühlt sich leer, ausgebrannt, ihre Gedanken sind wie Treibsand.
Die Stimme, ihre berufliche Existenzgrundlage als Sprecherin, versagt plötzlich den Dienst.
Der Arzt nennt es nüchtern eine Belastungsstörung. Was tun, wenn die Sprache versiegt, das eigene Instrument verstummt?
Der Vorschlag, über die Feiertage ein Hotel an der Algarve zu hüten, klingt da wie ein Rettungs– oder wie ein Fluchtversuch.
Kurz fragte sie sich, ob er sie loswerden wolle, heißt es über ihren Partner Jonas. Und auch ihre Freunde, denen sie davon erzählt, sind wenig begeistert. Sie denken sofort an Kubricks Shining.
Doch das Hotel Paraiso ist kein Spukschloss. Es ist ein kleines Haus an der Algarve mit 14 Zimmern, nah am Meer, und Frieda teilt es lediglich mit Labrador Otto. Ein leeres Hotel, das genug Raum lässt für die kreisenden Gedanken, für Erinnerungen und Brüche. „Allmählich bringt der Abend das Licht aus dem Grau“ (S. 16)
Weitholz findet Bilder, die wie poetische Polaroids wirken, leichte Momentaufnahmen, in denen Melancholie und Schönheit nebeneinanderstehen.
Die Autorin, selbst ist eine Vielgereiste. Sie schreibt hier Landschaften wie Postkarten, detailgenau und farbenprächtig.
Sie wechselt zwischen Gegenwart und Vergangenheit mit der Schnelligkeit von Gedankenblitzen. Dabei tauchen autofiktionale Elemente auf, wie Friedas Kindheit zwischen zwei Orten, geprägt von Fremdheitsgefühlen. In einem Nebensatz fällt wie beiläufig: Sie ist adoptiert.
„Ich war ein Pferd unter Kühen gewesen, das geglaubt hatte, es sei eine Kuh, aber das Gefühl nie losgeworden war, das irgendwas nicht stimmte,…“ (S. 151).
Frieda betreibt im stillen Hotel eine Art Nabelschau, stellt sich den großen Fragen nach dem Woher, Wohin, Warum.
Mal klingt das bedrängend, fast wie ein Regelwerk, das einem Lesenden übergestülpt wird. Dann wieder blitzt Witz auf, so unerwartet wie befreiend.
Wenn sie sich neben der Schwiegermutter fühlt „wie ein abgelaufener Joghurt“ oder einer Ballerina am liebsten zurufen möchte: „Boah, geiler Hopser“ (S. 59). In solchen Momenten wird sie sympathisch, nahbar! Eine, die stolpert, lacht und wieder aufsteht.
Weitholz versteht es, Figuren mit wenigen Strichen zu zeichnen, Karikaturen fast, die sich sofort einprägen. Das Buch wird zum Poesiealbum mit fröhlich, ironischen oder tiefsinnigen Einschreibungen.
Arezu Weitholz, Journalistin, Lektorin, Illustratorin, Multitalent, ausgezeichnet mit dem Hans-Fallada-Preis für Beinahe Alaska, bleibt auch in Hotel Paraiso eine, die Reisen nicht nur beschreibt, sondern verwandelt in Sprachbilder, in Erinnerungsräume, in ein poetisches Refugium, in dem es gleichzeitig eng und weit wird.
Und so liest sich das Buch wie ein Aufenthalt im titelgebenden Hotel. Es ist ein Rückzug ins Leere, in dem man sich mal verloren, mal aufgehoben fühlt. Ein lohnenswerter Aufenthalt.


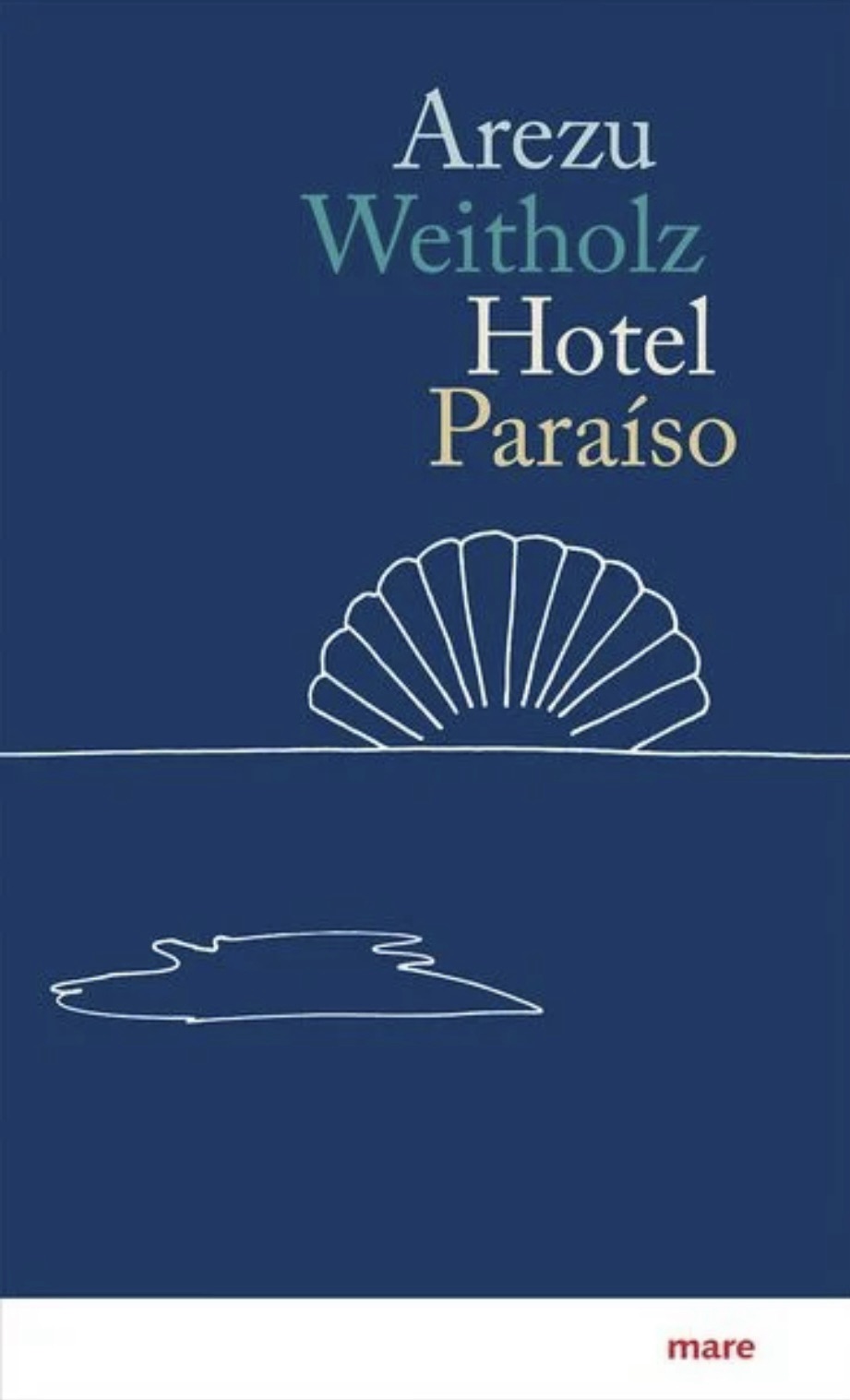
[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…