„So zog sich das Trauma wie eine schwarze Schlange durch die Stadt.“ Seite 153
Kaleb Erdmann macht es sich und den Lesenden nicht leicht. Dies vorweg!
Die Ausweichschule ist keine lineare Erzählung, kein klarer Bericht über den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Es ist eine spröde, tastende Annäherung an das eigene Erinnern – ein Text, der sich lange nicht greifen lässt. Man hadert gemeinsam mit dem Autor, man ringt mit ihm. Erst spät begreift man, welche Leistung dieses Buch erbringt.
Am 26. April 2002 erschießt ein ehemaliger Schüler 16 Menschen an seiner alten Schule. Erdmann war damals elf Jahre alt. Auch ihm begegnet der Täter – ein kurzer Moment, in dem er ihn für einen Ninja hält. In seiner Klasse fällt kein Schuss. Erst später hören sie die Schüsse. Die Panik setzt ein, als sie das Gebäude verlassen.
Die Schüler werden in eine Ausweichschule umgesiedelt.
Doch Erdmann will nicht nur erzählen, was geschehen ist. Er will erzählen, wie es sich erinnern lässt.
Das Buch entsteht Jahre später, ausgelöst durch eine Kneipenschlägerei – ein scheinbar banaler Auslöser, der eine Lawine innerer Auseinandersetzung lostritt. Es soll um mehr als den einen Tag in Erfurt gehen.
Die Mentale Überforderung während des Schreibprozesses lässt sehr Persönliches zur Sprache kommen. Seine Beziehung, ein früherer Drogenmissbrauch, der nachfolgende Angstattacken auslöst und derzeitige Therapie erfordert. Sacramento, Los Angeles S. 136
Erdmann nutzt sie als sogenannte Anker: mentale Fixpunkte, die helfen, in belastenden Momenten Orientierung zu behalten.
„Niederlande , Den Haag, Amsterdam ; Marokko Rabat, Casablanca, Kalifornien,“
Der Text hat keinen festen Aufbau. Er bewegt sich in Schleifen zwischen Recherche, Reflexion und Erinnerung. Anfang und Ende greifen ineinander. Einzelne Bilder blitzen auf: das beschriebene karierte Blatt mit „HILFE“ im Schulfenster, das Blumenmeer vor dem Gebäude, chaotisch gestellte Polizeiautos .
Doch nichts davon wird ausgeschlachtet – der Text verweigert sich konsequent jeder Sensation.
Immer wieder stellt sich die Frage nach Berechtigung: Muss man selbst traumatisiert sein, um über ein Trauma zu schreiben? Braucht Verarbeitung ein „Warum“?
Und wie lässt sich über ein solches Unglück schreiben, ohne es zur Schau zu stellen?
Erdmann formuliert diese Zweifel offen. Er beginnt, verwirft, wiederholt sich. Erkenntnisse tauchen auf, verlaufen ins Leere sind vorläufig oder bleiben. Der Lesersende begleitet ihn dabei – so nah, dass es manchmal wirkt, als schaue man durch ein beleuchtetes Fenster direkt in das private Innenleben des Autors.
Besonders stark sind die Metaphern zum Schreiben selbst. Etwa der Ordner auf dem Desktop, der „wie eine Winterjacke ganz hinten im Schrank“ hängt – „leicht geöffnet, seinen Inhalt andeutend“ (S. 45). Oder die Ablehnung gegenüber früherer Literatur zum Thema Amoklauf: kalte, harte Bücher, in denen der Autor seine eigene Erinnerung nicht wiederfindet.
Trotz aller Unsicherheit fühlt sich Erdmann dem Thema verpflichtet – oder wie er es nennt: „Erfurt“. Er sucht Halt in literarischen Vorbildern wie Emmanuel Carrère oder der fiktiven Dramatikerfigur, die ihm als Projektionsfläche dient. Die Tat von Erfurt verknüpft er mit anderen Amokläufen in Emsdetten, Winnenden, Hamburg.
Durch die bewusste Vermischung von Ebenen – privat, literarisch, gesellschaftlich – entsteht ein neuer Raum, der nicht Täter oder Opfer in den Mittelpunkt stellt, sondern den Umgang damit und dies ebenfalls auf allen Ebenen.
Gerade darin liegt die Stärke dieses Buchs: Die Tragweite der Tat wird greifbar, ohne ausgestellt zu werden. Die Ausweichschule ist keine Analyse, kein Tatsachenbericht, keine Autobiografie im engeren Sinne. Es ist der persönliche Versuch, mit dem Unerklärlichen zu leben. An das Ende meiner Ausführungen möchte ich gern eine bewundernswerte Frau stellen.
Die Frage von Frau Kluwe-Schleberger: Wie hätte es auch anders sein können?


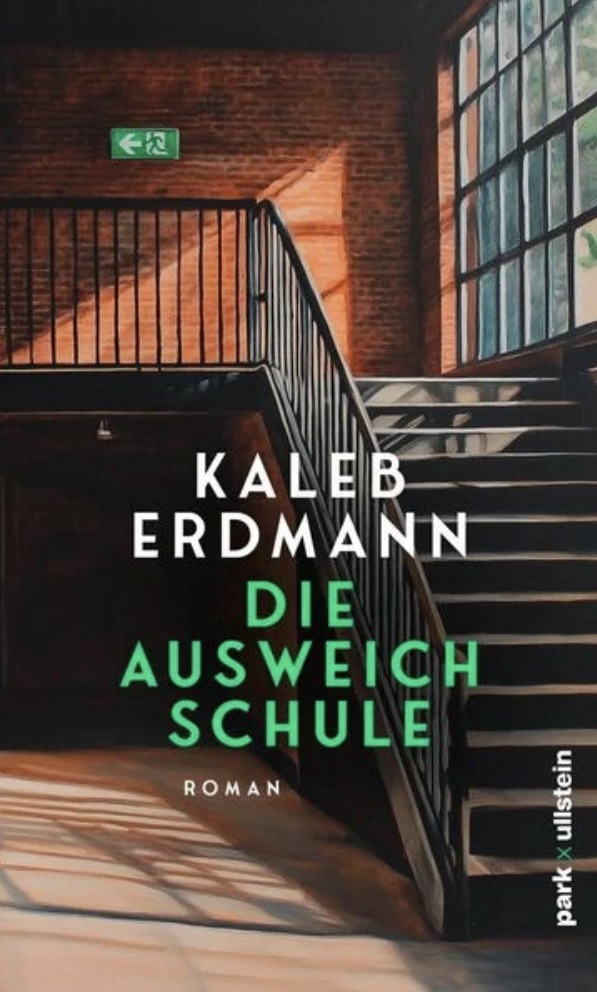
[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…