„Ich glaube, Paganini hat seine ganze verdammte Seele in das Geigenspiel gepackt.“ Genau, sagte er und dann nichts mehr.
Ein schwarzer Schwan zieht seine Kreise – leise, wie ein Schattenriss auf der glatten Oberfläche des Alltags. Theres Essmanns Roman Schwarzer Schwan ist ein zartes, melancholisches Kammerspiel, ein literarisches Adagio über Erinnerung, Musik und das Unverfügbare im Menschen.
Es beginnt mit einer stummen Begegnung: Federico Temperini, ein rätselhafter, betagter Herr, bestellt sich einen Chauffeur. Jürgen Krause, eigentlich Taxifahrer, nimmt ihn mit – erst widerwillig, dann fasziniert.
Der Alte scheint mehr zu suchen als eine bloße Fahrt durch die Stadt.
In seiner wortkargen Art, in seinem Habitus liegt ein Sog. Etwas an seiner linken, stets versteckten Hand, an seinem aristokratischen Gestus und der leisen Dringlichkeit seiner Wünsche. Er zieht Krause, den Mann von der Straße, hinein in ein Paralleluniversum aus Musik und Erinnerung.
Zweisträngig erzählt Essmann ihre Geschichte: auf der einen Seite die Lebenswelt des Taxifahrers Krause – schnörkellos, bodenständig, sprachlich geerdet. Auf der anderen Seite entfaltet sich durch Temperinis Erzählungen das schillernde, tragische Porträt Niccolò Paganinis, des „Teufelsgeigers“, der sich wie ein Phantom durch die Musikgeschichte zieht. Schon früh zeichnet eine Nähe zu Paganini ab.
Sprachlich gelingt der Autorin ein raffiniertes Spiel mit Nähe und Distanz, mit Andeutung und Auslassung.
Erste Dialoge wirken zunächst wie hingeworfene Köder – “Worthappen”, die mehr verschweigen als enthüllen. Und doch wird in der Stille zwischen den Worten eine Beziehung komponiert, die sich nach und nach zu einem Duett verdichtet: zwischen Krause, dem einfachen Beobachter, und Temperini, einem Mann, der aus der Zeit gefallen scheint – wie Paganini selbst, missverstanden, verehrt, einsam.
Zentral-Paganini, der Sprachlose, der Unberührbare – seine Geige war seine Stimme, seine Krankheit der Preis für den Genius. In Essmanns Prosa klingt diese Tragik in sanften Moll-Tönen nach. Besonders eindrücklich: die Szene auf dem Friedhof, bei Mondlicht, wenn Paganini für die Toten spielt. Musik, die tröstet, verbindet, erlöst – und am Ende doch nur das Echo eines Unverstandenen bleibt.
Theres Essmann schreibt mit einer leisen Musikalität, mit melodischen Sprachbildern, die wie das Licht des Mondes auf Wasser schimmern: „Der Mond hing in einem Rest von Blau am Abendhimmel über Brücke und Rhein, eine schmale weiße Sichel.“ Solche Sätze verharren flüchtig wie ein letzter Geigenton, bevor der Bogen zur Ruhe kommt.
Die große Frage bleibt: Warum gerade Krause? Warum dieser Mann, ohne Bezug zur klassischen Musik, ohne Offenheit für das Transzendente? Vielleicht, weil er Temperinis Archille ist – ein gedachter Sohn, ein Nachfahre im Geiste, ein Gefäß für die letzte Erzählung. Eine Idee, zugegeben, fast zu schön, um wahr zu sein. Aber Literatur lebt von solchen Vermutungen, und Schwarzer Schwan ist voller solcher zarter Hypothesen.
Am Ende schließt sich der Kreis. Ein letzter Akkord – nicht laut, nicht pathetisch, sondern verhallend unter dem Mondlicht. Kein großes Crescendo, sondern ein stiller Applaus im Herzen des Lesers.
Ein Buch wie ein Nocturne: nachdenklich, innig, voll zarter Dissonanzen. Essmann gelingt mit Schwarzer Schwan ein literarischer Geigenstrich über das Unsagbare, über die Brücken, die Musik schlagen kann – zwischen Zeiten, zwischen Seelen. Und vielleicht auch zwischen Vätern und Söhnen.


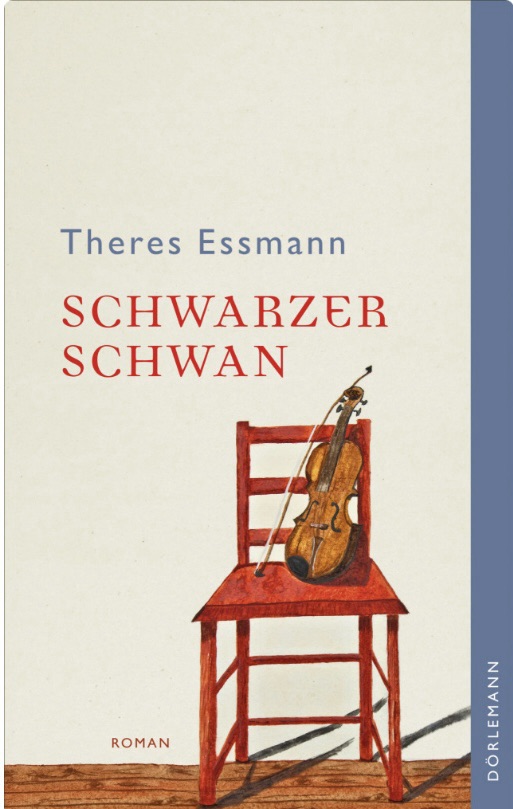
[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…