Zu Jonas Lüschers „Verzauberte Vorbestimmung“ – nominiert für den Deutschen Buchpreis 2025
Wer sich auf Jonas Lüschers neuen Roman Verzauberte Vorbestimmung einlässt, betritt ein sprachliches Labyrinth, dessen Wände aus Wortgirlanden und Reflexionen bestehen. Es ist ein Intellektuellenroman, der in Sphären schwebt zu denen man sich aufmacht ohne leichten Einfluss oder Gegenliebe zu finden.
Eine erste Orientierung gelingt paradoxerweise nicht durch den Text selbst, sondern durch das Bedürfnis, über ihn zu sprechen, ihn zu besprechen. Denn der Roman, so elaboriert er daherkommt, entzieht sich jeder unmittelbaren Leselust. Die Stimmung ist düster, dystopisch, schwer: Krieg, Tod, Verlassenheit, Schmerz. All das drückt, statt zu heben. „Die Schwere saß mir in der Brust und schwappte wie trauriger, öliger Wellengang in meinem Schädel…“ (S. 313). Ein Satz wie ein Seismograph für das Gewicht des Ganzen.
Der Ich-Erzähler – in seiner fiebrigen, deliranten Körperlichkeit unverkennbar mit dem Autor verwandt – taumelt durch die Zeiten, verfolgt von der eigenen Schwere, von Schmerzen, von einer Todessehnsucht, die sich als Motor des Textes erweist. Der Leser stolpert mit, denn Zeit, Ort und Perspektive wechseln wie Schatten in einer flackernden Landschaft.
Und doch: Der Roman ist kein reines Trübsal. Es gibt Episoden, die mit greller, fast sadistischer Schönheit aufleuchten – etwa der Giftgasangriff: „sprachlos blickt er in den gelben Himmel über ihn, aus dem sich kräuseln Fasern senken, die sich wie brennenden Nessl Fäden über sein Gesicht legten, in seine Augen flammten, in seine Lunge drangen, sich mit Gewalt in seinem Körper Platz zu schaffen, versuchten und alles Leben aus ihm heraus drängen wollten, wie Geister, die sich seines Leibes bemächtigten“ (S. 18). Solche Bilder fräsen sich ein.
Überhaupt: Die Phantastik lauert überall. Ein sphinxhafter Vogel auf der Schulter des Erzählers, geheimnisvolle Informationskügelchen, ein Schweben zwischen Wahn und Wunder. Alles atmet die Aura des Fiebertraums – oder ist es ein Drogentrip? Dass der Erzähler schließlich auf einer Intensivstation erwacht- coronainfiziert-lässt den gesamten Roman wie eine gigantische Halluzination wirken, gehalten von Maschinen, gespeist daraus in der Grauzone zwischen Leben und Tod.
Im Finale jedoch – und das ist der Clou – erlangt der Text eine beinahe gnostische Dimension: Der Mensch verschmilzt mit der Maschine, überschreitet die Grenzen des Körpers, fließt ins Reich des Digitalen und verbindet sich schließlich mit der Natur. Ein Blick in Zukünftiges?
Nach der Überwindung der Materie bleibt nur noch das reine Empfinden. So endet ein Buch, das dort anfängt, wo andere aufhören: im Auflösen der Grenzen, im Schaffen einer neuen Realität.
Empfehlung? Für Intellektuelle, Altphilologen, vergeistigte Sprachliebhaber – mit Hang zum Selbstzerstörerischen (nicht unbedingt in der Reihenfolge und nicht ganz ernst gemeint).
Wer hier einsteigt, sollte wissen: Es gibt kein Geländer, nur den Sog der Worte. Aber für jene, die Lust auf etwas Forderndes haben, ist dieser Roman ein Fest.


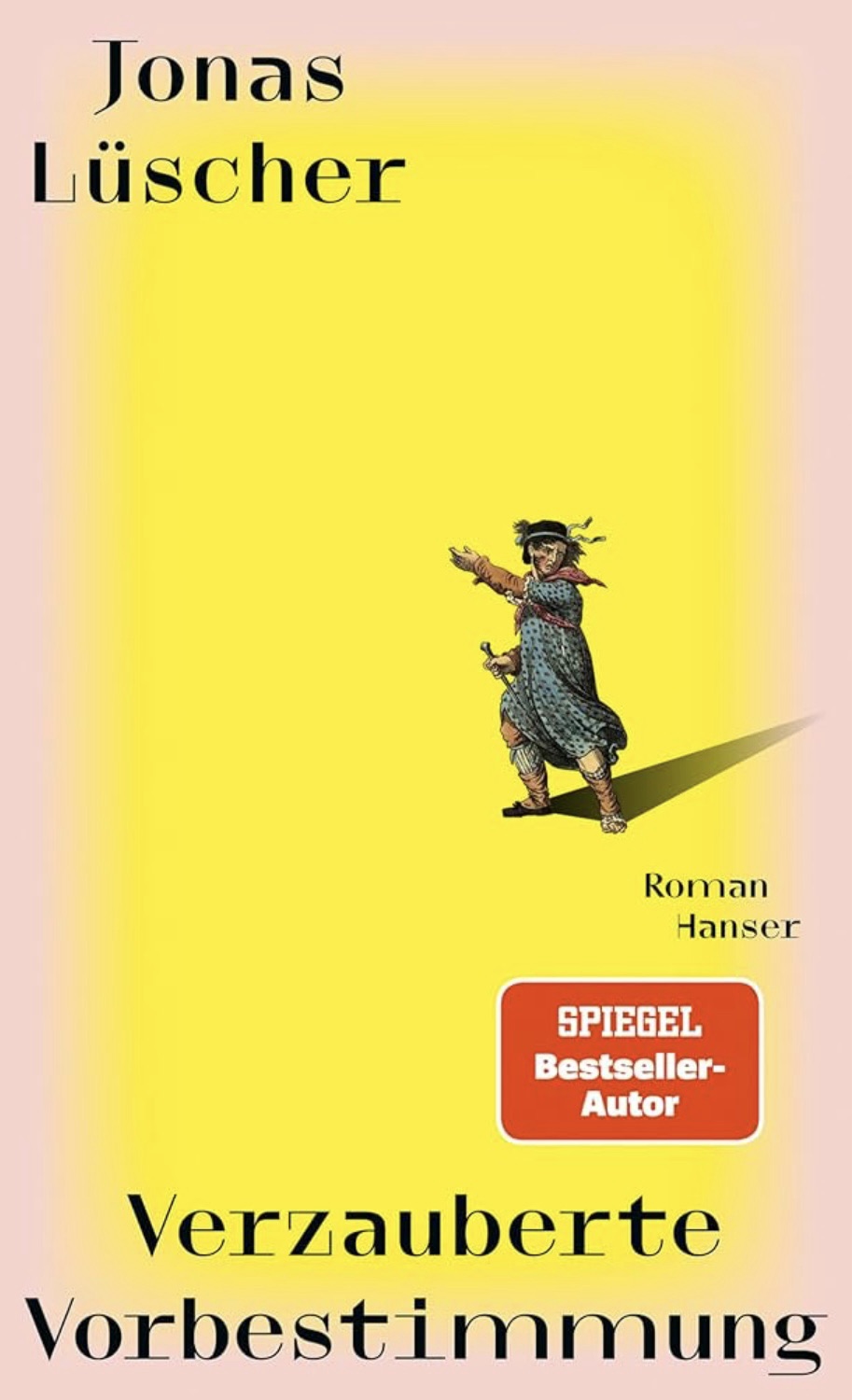
[…] „Dieser Band ist keine späte Gedenkplatte, sondern ein Monsterbrillant aus dem Tiefsee‐Schatz der deutschsprachigen Literatur: 15 Geschichten, die zeigen,…